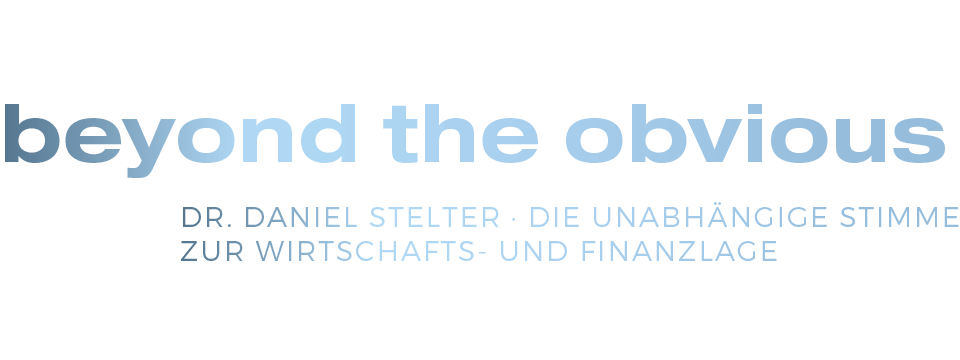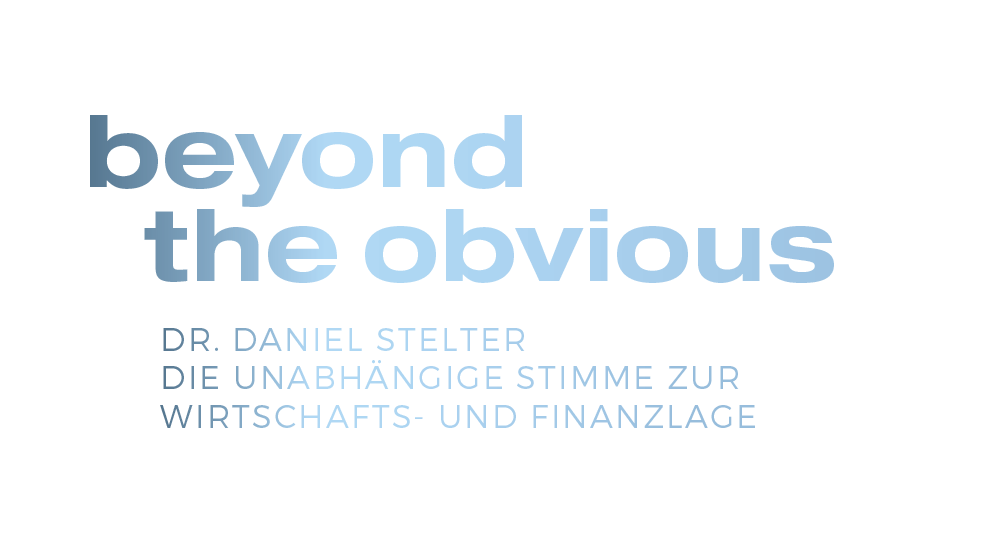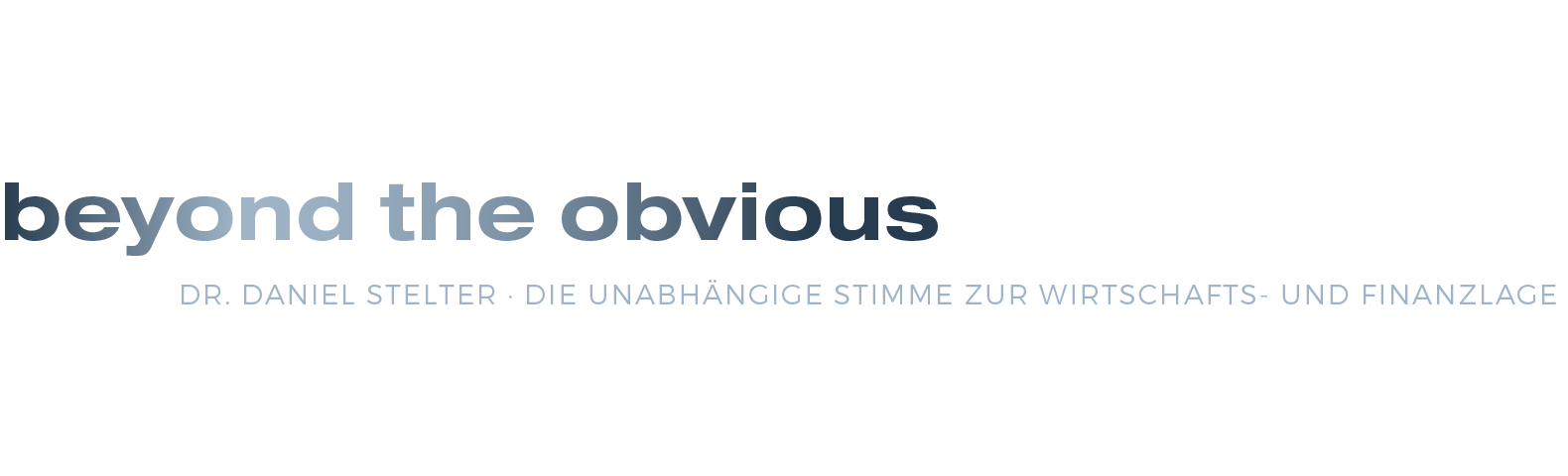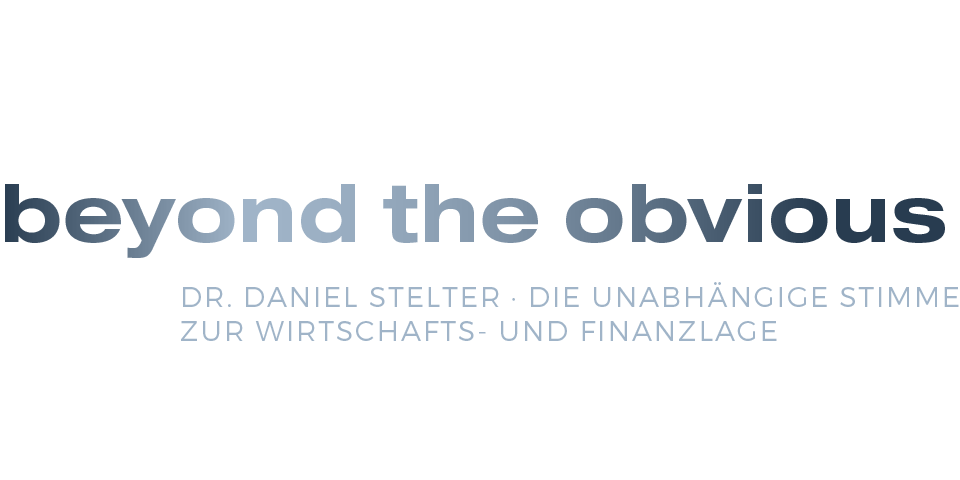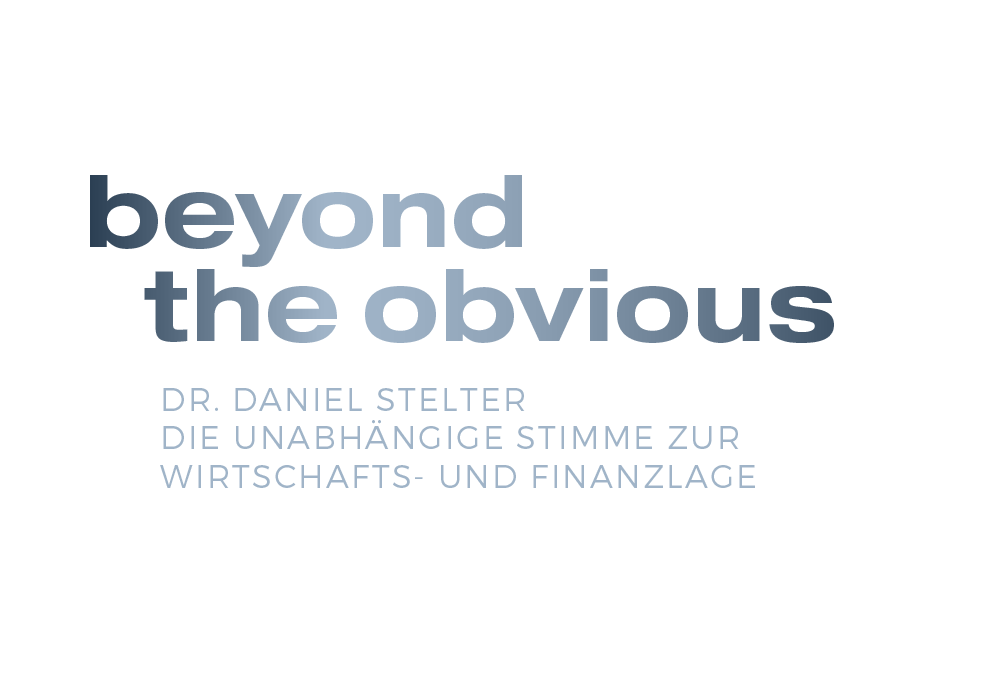„Schwarze Null“ statt nachhaltiger Finanzen – nicht nur die öffentliche Infrastruktur verfällt
Diesen Auszug aus meinem neuen Buch „Das Märchen vom reichen Land – Wie die Politik uns ruiniert“ publizierte WirtschaftsWoche Online. Das Buch erscheint am 10. September im Münchener Finanzbuchverlag (FBV):
Auch in Deutschland fehlt nicht viel bis zu einstürzenden Brücken, denn unser Staat investiert seit vielen Jahren zu wenig in die öffentliche Infrastruktur. Das wird sich rächen. Dabei könnte es der Staat viel besser.
Freude überall. Im Frühjahr 2018 melden die Nachrichtenagenturen, dass Deutschland früher als erhofft wieder einen Schuldenstand von unter 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen wird. Schon 2019 sollen die Schulden auf 58 Prozent des BIP sinken, damit unter das im Maastricht-Vertrag zur Euroeinführung vorgesehene Höchstniveau und bis 2021 auf 53 Prozent des BIP. Das Finanzministerium rechnet bis 2021 durchgehend mit Überschüssen von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen zwischen 1 und 1,5 Prozent des BIP. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich dazu verpflichtet, die „Politik der schwarzen Null“, also den Verzicht auf neue Staatsschulden, fortzusetzen.
Der (bisherige) Höchststand der Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt von 81 Prozent war im Jahr 2010 erreicht worden. Also eine echte Erfolgsstory unserer Politiker, die damit vielleicht kompensieren wollen, dass die privaten Haushalte in Deutschland nicht so vermögend sind? Ein relativ reicher Staat (weil weniger verschuldet) als Trost für die kleineren Vermögen und damit als zukünftig geringere Belastung, weil wir ja vorgesorgt haben?
Leider nein. Diese Hoffnungen muss ich sogleich enttäuschen. Die „schwarze Null“ und ihre Folgen sind eine der großen Täuschungen der Politik, die unseren Wohlstand nicht mehrt, sondern zusätzlich mindert.
[…]
Die „Sparleistung“ von Wolfgang Schäuble, Scholz’ Vorgänger im Amt des Bundesfinanzministers, lag also darin, die Ausgaben weniger stark wachsen zu lassen als die Einnahmen. Da ein guter Teil der Ausgaben jedoch ohne jegliches Zutun der Politiker gesunken ist, nämlich die Finanzierungskosten, ist sie nur unter politischen Gesichtspunkten eine „Leistung“. Schäuble hat immerhin noch höheren Ausgabenwünschen der Kabinettskollegen widersprochen.
Die Nebenwirkungen der „schwarzen Null“ sind erheblich. Zum einen fördert das staatliche Sparen zusätzlich den Ersparnisüberhang bei uns, der mit den Exportüberschüssen korrespondiert. Zum anderen haben die Politiker am falschen Ende die Ausgaben gekürzt. Nämlich bei der Zukunftsfähigkeit unseres Landes.
[…]
Verfall der Zukunft
Unternehmen und Staat investieren in Deutschland seit Jahren zu wenig. Eine Vielzahl von Studien analysiert diese Entwicklung, und an Appellen an die Politik, dies zu ändern, mangelt es nicht. Bisher jedoch vergeblich.
Investitionen bestimmen das gesamtwirtschaftliche Produktionspotenzial und damit die Einkommen, die im Inland entstehen werden. Gerade angesichts der absehbaren demografischen Entwicklung – Forscher erwarten alleine aufgrund des Bevölkerungsrückgangs in den kommenden Jahren eine Halbierung der Wachstumsraten – kommt der aktuellen und zukünftigen Investitionstätigkeit eine entscheidende Bedeutung zu. Umso schlimmer ist es, dass die Investitionen seit Beginn des Jahrtausends gesunken sind. Wurden in Deutschland in den 1990er-Jahren noch Nettoinvestitionen (also Bruttoinvestitionen abzüglich der Abnutzung des vorhandenen Kapitalstocks) im Umfang von rund 7,5 Prozent des BIP getätigt, so sank die Quote auf 2,2 Prozent im Zeitraum von 2010 bis 2016. Dabei war die Investitionstätigkeit in den 1990er-Jahren sicherlich auch wegen der Wiedervereinigung auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.
[…]
Besonders schlecht ist die Entwicklung des Nettoanlagevermögens beim Staat. Seit 1991 veraltet das staatliche Vermögen zusehends. Die Investitionen in den Kapitalstock haben sich gegenüber den frühen 2000er-Jahren mehr als halbiert, was zu einer immer älteren staatlichen Infrastruktur führt. Die Abgänge aus Abschreibungen wurden nicht ersetzt. Wir leben von der Substanz, lassen unsere Infrastruktur verfallen und feiern zugleich die „schwarze Null“ als politischen Erfolg, dabei hätte man die Gelder anderweitig verwenden können und müssen. Um einen Verfall des Kapitalstocks und damit der Zukunftsfähigkeit des Landes zu stoppen, muss dringend mehr investiert werden.
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) kommt angesichts dieser Entwicklung zu einer ernüchternden Aussage: „Die dargelegte Entwicklung der Sachinvestitionen gefährdet das wirtschaftliche Potenzial Deutschlands. Denn öffentliche Investitionen sind von sehr großer Bedeutung, da sie die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Infrastruktur sichern, welche die Grundlage für private Investitionen bildet.“ Alles, was vor dem Jahr 1990 gebaut wurde, dürfte zur Grundsanierung anstehen, so die Forscher.
[…]
Das IW dazu: „Die Folgen dieser Altersstruktur zeigen sich derzeit am deutlichsten an den Brückenbauwerken. Fast die Hälfte der Autobahnbrücken (gemessen nach Brückenfläche) wurde zwischen 1965 und 1975 gebaut. Diese Brücken waren nie für die heutigen Verkehrsmengen ausgelegt und wären selbst bei guter Pflege heute für eine Grundsanierung fällig gewesen.
Tatsächlich müssen viele dieser Brücken aber ersetzt werden, da ihr baulicher Zustand als wirtschaftlicher Totalschaden einzustufen ist. Prominentestes Beispiel ist die Leverkusener Brücke. Aber auch die 14-tägige Vollsperrung der A 40 im August 2017 fällt in diese Kategorie. Im Sommer 2017 berichtete die Bundesregierung, dass etwa 14 Prozent der Autobahnbrückenfläche in die Zustandskategorie „nicht ausreichend“ oder schlechter fallen. Diese Brücken sind häufig in der Nutzung eingeschränkt, etwa durch Tempolimits oder Teilsperrungen. Von den Brücken in kommunaler Baulast fielen im Jahr 2013 rund 19 Prozent in die kritischen Kategorien. Etwa 10 000 kommunale Brücken galten als nicht mehr sanierungsfähig und müssen ersetzt werden.“
Bei den Straßen sieht es nicht besser aus, bei denen seit dem Jahr 2000 ebenfalls von der Substanz gelebt wird: „Die vorliegenden Daten zeigen, dass von etwa 13 000 Kilometern Autobahn 17,5 Prozent der Streckenkilometer sanierungsbedürftig sind. Bei den Bundesstraßen sind es 33,9 Prozent von gut 39 000 Streckenkilometern. Mehr als 10 Prozent der Autobahnen und fast 19 Prozent der Bundesstraßen müssten sogar umgehend saniert werden. Dabei ist davon auszugehen, dass der Zustand der Bundesfernstraßen noch spürbar besser ist als der Landes- oder Kommunalstraßen. So ergab beispielsweise die letzte Erfassung der Landesstraßen in NRW, dass fast 50 Prozent der Streckenkilometer in den kritischen Kategorien anzusiedeln waren. Die auf den Erhaltungsausgaben des Landes basierenden Prognosen gehen davon aus, dass besonders der Anteil der sehr schlechten Straßen bis 2028 drastisch steigen wird.“
Ein Bild, welches sich mit dem subjektiven Gefühl der Bevölkerung decken dürfte. Immer wenn ich in Nachbarländern unterwegs bin, mit der Schweiz sicherlich als auffälligstem Beispiel, erlebe ich deutlich den Unterschied. Dabei ist es nicht nur die öffentliche Infrastruktur, die verfällt. Deutsche Schulen leiden nicht nur an undichten Dächern und kaputten Toiletten, sondern auch an Lehrermangel und unzureichender technischer Ausstattung. Die Bundeswehr ist eine Lachnummer ohne funktionsfähiges Material. Es fliegt, schwimmt und fährt fast nichts mehr und die Soldaten haben nicht mal ausreichend Winterbekleidung!
Wir haben eine öffentliche Infrastruktur, die nun wahrlich nicht zum politischen Kampagnenimage des „reichen Landes“ passt. Arme Privathaushalte, armer Staat, armes Deutschland wäre meine Zusammenfassung. Abgewirtschaftet von einer Politik, die trotz rekordhoher Abgabenbelastung nicht in der Lage ist, die Gelder für die Sicherung der Zukunft einzusetzen.
[…]
Die Folgewirkungen sind erheblich:
- Die öffentliche Infrastruktur verfällt, und zwar nicht nur die bauliche, sondern auch im Bereich der Bildung (Lehrer), da auch dort die Ausgaben seit Jahren gesunken sind.
- Unternehmen investieren weniger hierzulande – Stichwort: rückständige digitale Infrastruktur –, weil die Umfeldbedingungen nicht mehr adäquat sind.
- Die Überschüsse des Staates drängen die Ersparnisse der hiesigen Bevölkerung ins Ausland.
- Die Tendenz zu Exportüberschüssen wird gefördert und damit das Ungleichgewicht unserer Volkswirtschaft verstärkt, was wiederum das Risiko von Protektionismus und Spannungen im Euroraum erhöht.
- Die schlecht verzinslichen und hoch risikobehafteten Forderungen gegenüber dem Ausland wachsen so weiter an.
Die „schwarze Null“ hätte man auch auf anderem Wege erreichen können, indem man statt an Investitionen an staatlichem Konsum gespart hätte. Wann, wenn nicht im Boom, hätte die Regierung die Sozialausgaben zurückführen können und müssen? Dann wäre das Lob für Wolfgang Schäuble berechtigt. So war es ein bequemer Weg, der uns auf verschiedene Weise noch teuer zu stehen kommen wird.
Staatsschulden sind nicht schlecht
Das führt zu der Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, um jeden Preis im Staatshaushalt zu sparen. Zweifel sind angebracht. Natürlich soll ein Staat nicht übermäßig Schulden machen und gezielt auf einen Staatsbankrott hin wirtschaften. Ein gewisses Maß an Verschuldung ist jedoch mit Blick auf die Verwendung der inländischen Ersparnis nicht falsch. Nicht zu Unrecht waren die Maastricht-Kriterien ein Schuldenstand von maximal 60 Prozent des BIP und ein laufendes Defizit von maximal 3 Prozent. Bei einem Schuldenstand von 60 Prozent und einem damals noch normalen Zinsniveau von 5 Prozent kann der Staat sich jedes Jahr nämlich das Geld für die Zinszahlungen leihen und die Schuldenquote bleibt bei einem Nominalwachstum von 3 Prozent unverändert. Allein dies führt schon zu der Frage, ob es sinnvoll ist, wie jetzt geplant, auch nach der Erreichung der Zielmarke beim Schuldenstand von 60 Prozent vom BIP weiter an der „schwarzen Null“ festzuhalten.
[…]
Da die privaten Haushalte mit Blick auf die Altersvorsorge in der Tat sparen sollen, bleibt nur eine Reduktion der Ersparnisse der Unternehmen durch entsprechende Investitionsanreize oder eine höhere Besteuerung und ein Defizit des Staates. Eine zusätzliche Belastung der privaten Haushalte verbietet sich von selbst, weshalb die ganze Steuererhöhungsdiskussion grundfalsch ist. Wir brauchen keine höhere Steuer für „Reiche“, wir brauchen keine Abschaffung der Abgeltungssteuer, keine höhere Erbschaftssteuer und auch keine Vermögenssteuer. Wir brauchen Unternehmen, die mehr investieren – oder eben, wenn sie es nicht tun, mehr Steuern zahlen –, und einen Staat, der mehr ausgibt.
Und zwar:
- für eine breite Entlastung der Steuerzahler;
- für eine Investitionsoffensive in Infrastruktur von Straßen bis schnelles Internet;
- für eine Bildungsoffensive, um die nächste Generation fit zu machen für die Industrie 4.0;
- für die Korrektur sozialer Probleme, vor allem wiederum die Verbesserung der Chancengleichheit durch bessere Bildung für alle.
Das Geld dafür ist da und es ist allemal besser, es im Inland auszugeben, als es im Ausland zu verlieren.
[…]
Was mich zu dem sehr ernüchternden Schluss führt: Obwohl wir dem Staat im Vergleich zu anderen Ländern einen sehr erheblichen Anteil unserer Einkünfte abtreten, sind wir mit Blick auf das vom Staat verwaltete Vermögen schlecht aufgestellt. Die Infrastruktur verfällt, die Bundeswehr ist alles, nur nicht wehrfähig und die Bildungssysteme befinden sich in einer tiefen Krise.
Damit reduziert sich das Wachstumspotenzial Deutschlands und somit die Fähigkeit, in Zukunft höhere Lasten zu schultern. Die Politiker bevorzugen Konsum statt Investition und setzen auf Umverteilung von Wohlstand, statt Schaffung von Wohlstand.
Derweil wachsen die Schulden des Staates weiter an, weil die Politiker die Zusagen für künftige Leistungen erhöhen, was nur mit deutlich steigenden Schulden oder Abgaben zu finanzieren ist.
Beides führt zu einer Minderung der Privatvermögen in der Zukunft.
→ wiwo.de: “Es ist nicht nur die öffentliche Infrastruktur, die verfällt”, 16. August 2018