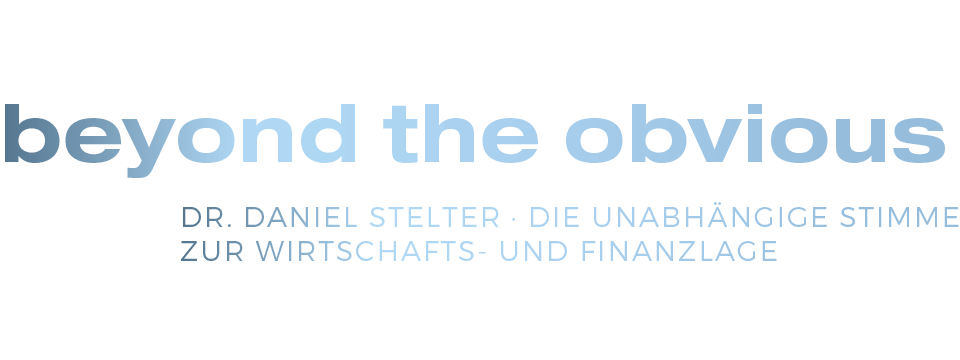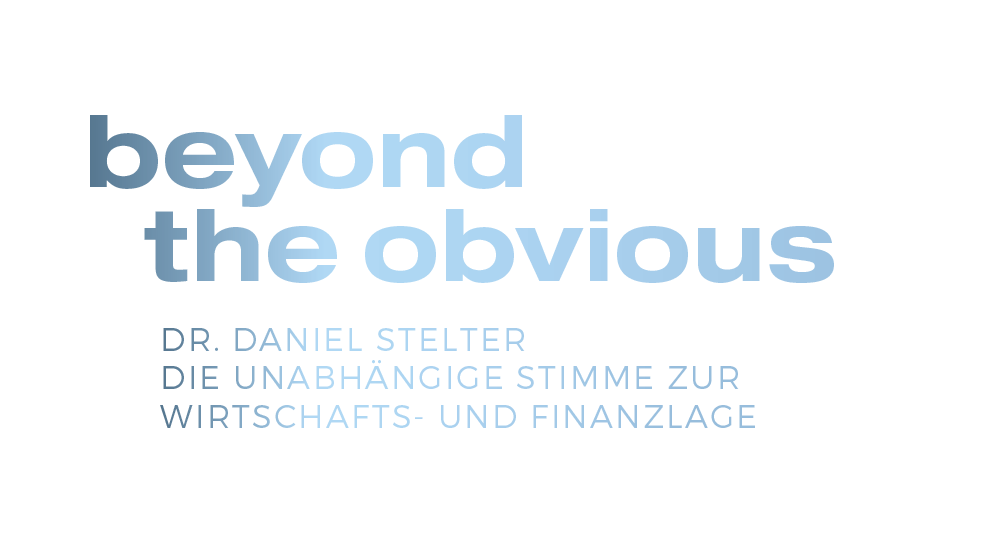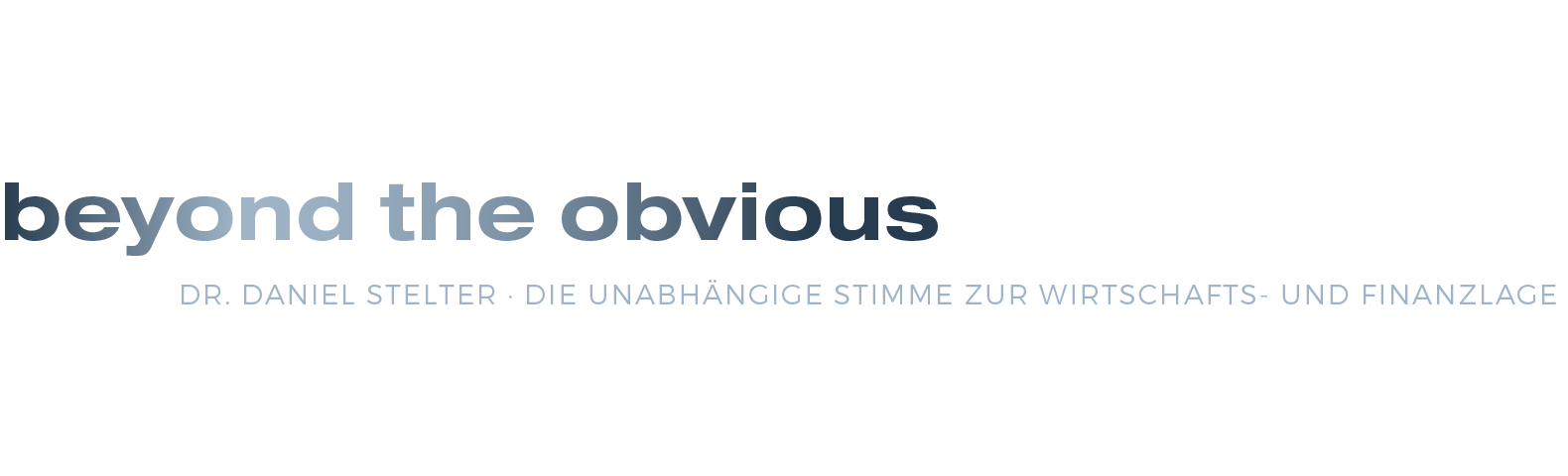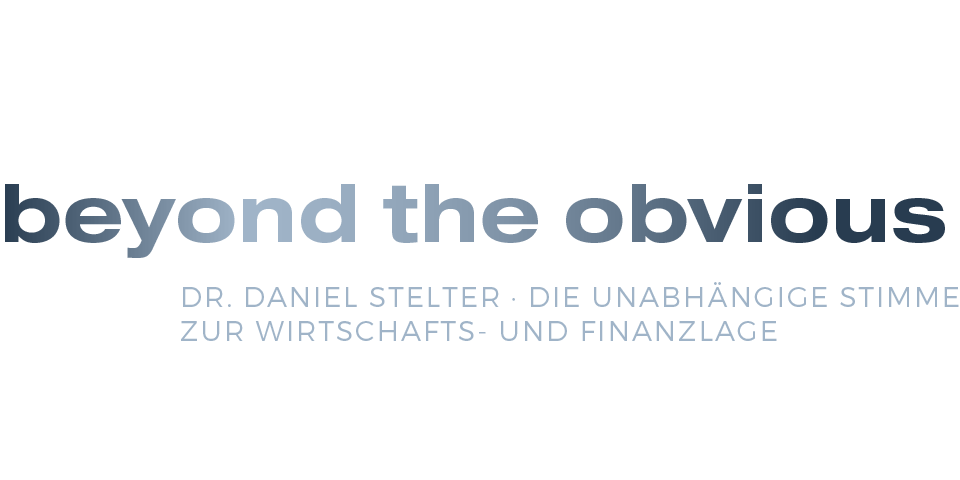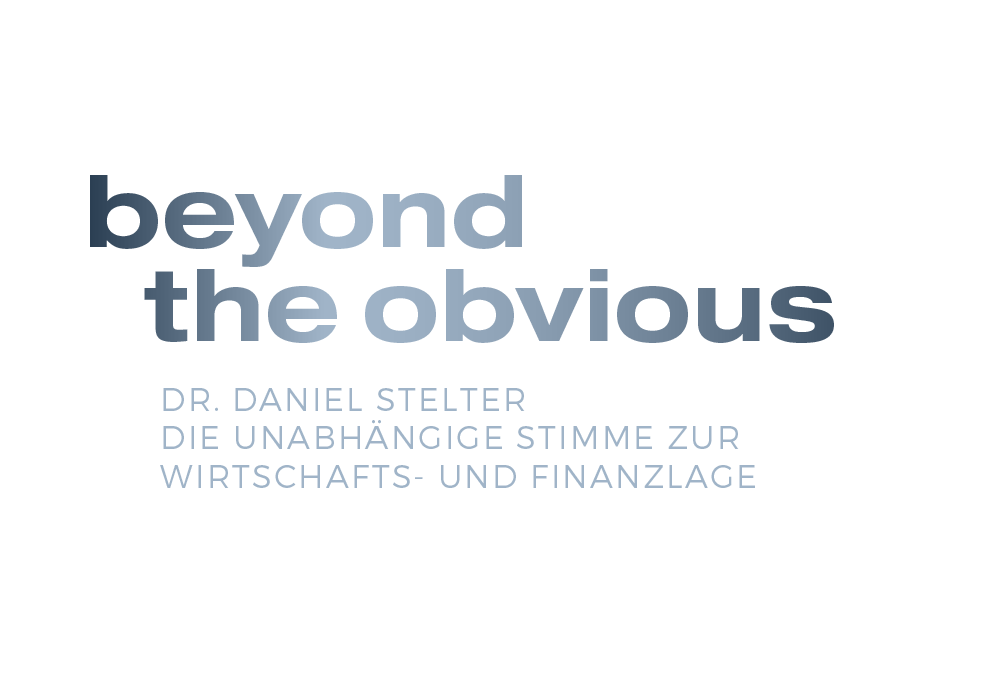The productivity puzzle
Gestern habe ich von der Demografie gesprochen, die eine erhebliche Last für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung darstellt. Lösung? Eine erhebliche Steigerung der Produktivität pro Kopf, zum Beispiel durch vermehrten Einsatz von Robotern.
Doch wo steht die westliche Welt mit Blick auf die Entwicklung der Produktivität? Wie berichtet, ist die Produktivität im letzten Jahr weltweit gesunken. Gerade in Europa sehen wir seit Jahren eine rückläufige Produktivität. Experten wie Professor Robert Gordon erwarten auch für die Zukunft immer geringere Produktivitätszuwächse. Hier ein Beitrag aus der FT zum Thema. Kernaussagen:
- In den letzten 120 Jahren ist das BIP pro Kopf („Output“) mit einer jährlichen Rate von zwei Prozent gewachsen.
- Eine Fortsetzung ist fraglich. Experten – wie der bereits genannte Professor Gordon – erwarten nur noch ein Prozent pro Jahr in der Zukunft.
- Auch die Fed geht von strukturell tieferen Wachstumsraten in Zukunft aus.
- Optimisten wie Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee vom Massachusetts Institute of Technology erwarten hingegen eine von neuen Technologien getriebene Beschleunigung des Wachstums der Produktivität pro Kopf. Und in der Tat gibt es Beispiele wie Climate Corporation, die Farmern helfen, durch Optimierung jedes einzelnen Arbeitsschrittes den Ertrag um mindestens fünf Prozent zu steigern.
- Damit wird die Frage der Entwicklung der Produktivität entscheidend für die US-Wirtschaft. Entscheidend für Wachstum, Zinsniveau und Schuldentragfähigkeit. Gleiches gilt für Europa.
- Was die anderen Treiber des Wachstums betrifft, sind sich alle Beobachter einig: Aus Bevölkerungswachstum, Bildung und Investitionen ist nicht mehr viel zu erwarten.
- Gerade bei den Themen Ausbildung und Fähigkeiten ist ein schlechter Trend unverkennbar (und nicht nur in den USA!!). Kostet die Demografie alleine rund 0,3 Prozent-Punkte Wachstum, kostet die schlechte Bildung weitere 0,2 Punkte.
- Damit sind wir auf technologische Innovation angewiesen. Hier tobt der Streit zwischen Optimisten (Brynjolfsson) und Pessimisten (Gordon). Zwischen 1972 und 1996 verlangsamte sich das Produktivitätswachstum auf 1,4 Prozent, um im Zuge des Internetbooms wieder auf Werte von 2,5 Prozent bis 2004 zu steigen. Seither ging es wieder zurück auf nunmehr 1,3 Prozent. Kommt nun wieder eine Periode hoher Wachstumsraten oder eher eine anhaltende „säkulare“ Verlangsamung?
- Die Optimisten verweisen auf Erfindungen wie Googles selbstfahrendes Auto. Sie sind damit aus meiner Sicht in der Tradition der Kondratieff-Zyklen, die ihre Ursache ebenfalls in Basisinnovationen haben. Letztere treiben dann einen fundamentalen Wandel der Wirtschaft voran, der die Wirtschaft gesamthaft voranbringt.
- Die Pessimisten machen einen einfachen Punkt: Die Erfindungen der Vergangenheit waren viel fundamentaler als die heutigen. Fließendes Wasser zu Hause, der Verbrennungsmotor und die Glühbirne waren schlichtweg wichtiger als die heutigen Erfindungen. Deshalb kann die Wirkung heute auch nicht so groß sein.
- Beide Lager machen dabei vielleicht einen Fehler: Sie versuchen zu schätzen, was noch alles erfunden werden könnte. Und beide können nicht die tatsächliche Entwicklung erklären. Gordon nicht den Zuwachs an Produktivität seit 1998, Brynjolfsson nicht den Rückgang seit 2004.
- Besser wäre ein anderer Blick. Wichtiger könnte sein, wie viele Menschen in der Forschung arbeiten. Zwar wirkt auch hier der Rückgang der Bevölkerung, aber der Anteil der Forscher könnte gesteigert werden (wenn man denn die Bildung verbessern würde). Andererseits gibt es noch viel Forscher-Potential in den bevölkerungsstarken Ländern wie China und Indien. Davon würden auch die USA (und Europa) profitieren.
Ich denke auch, dass der Anteil der Forscher eine erhebliche Wirkung hat. Ich denke auch, dass wir noch lange nicht am Ende der Innovationen stehen. Aber: Es ist nicht egal, wo es stattfindet! Dort wo sie stattfindet, entsteht Wohlstand.
→ FT (Anmeldung erforderlich): US economy: The productivity puzzle, 29, Juni 2014