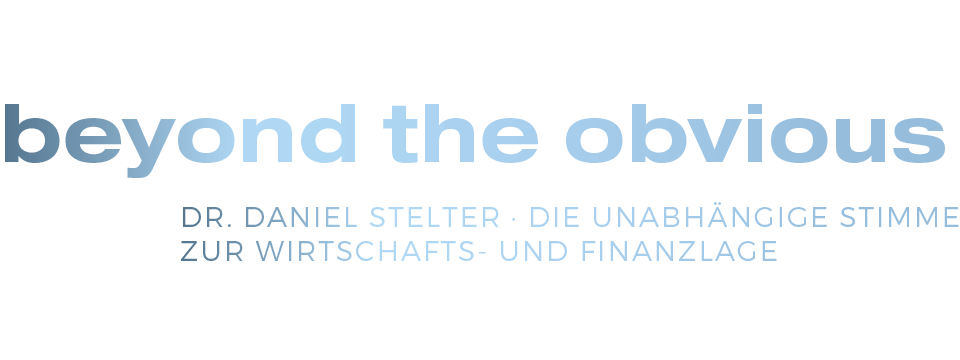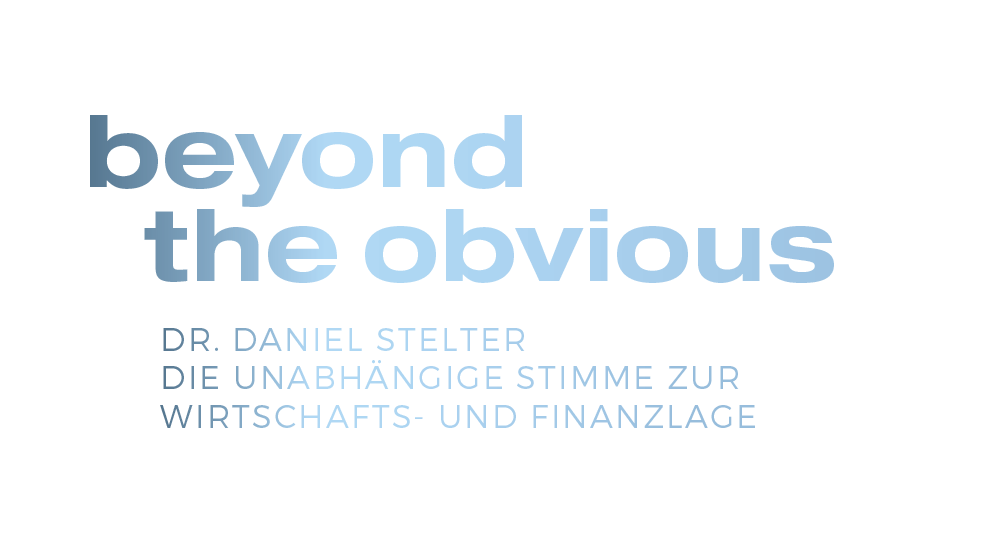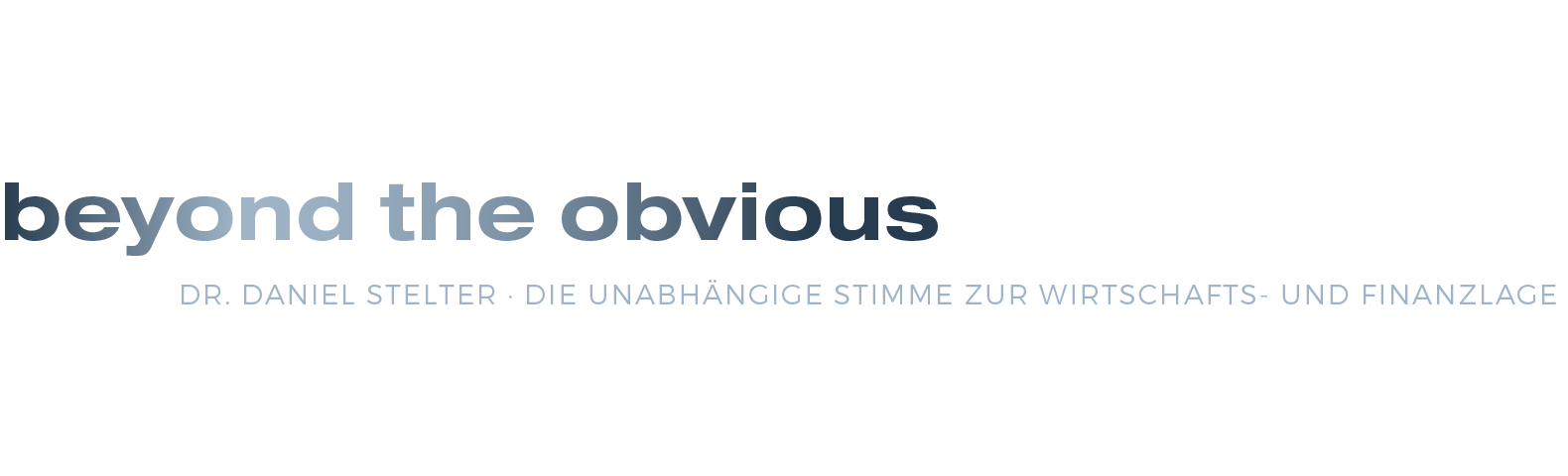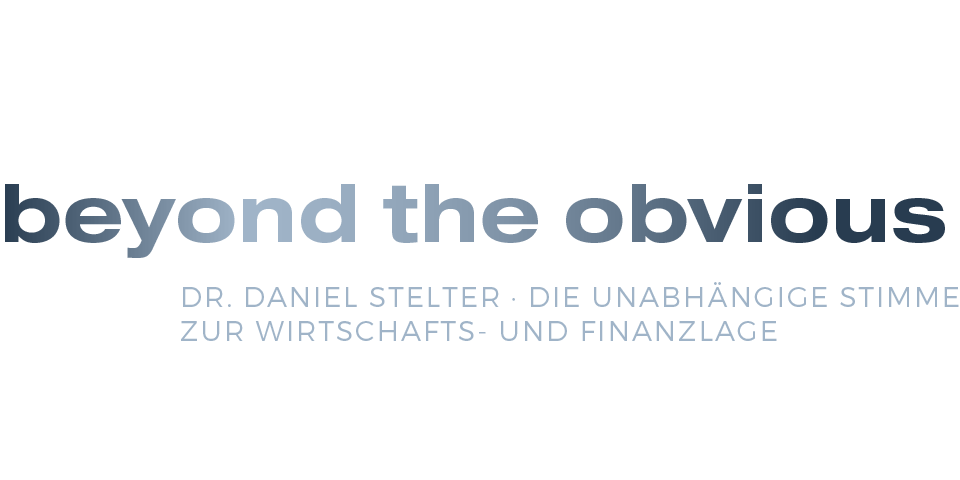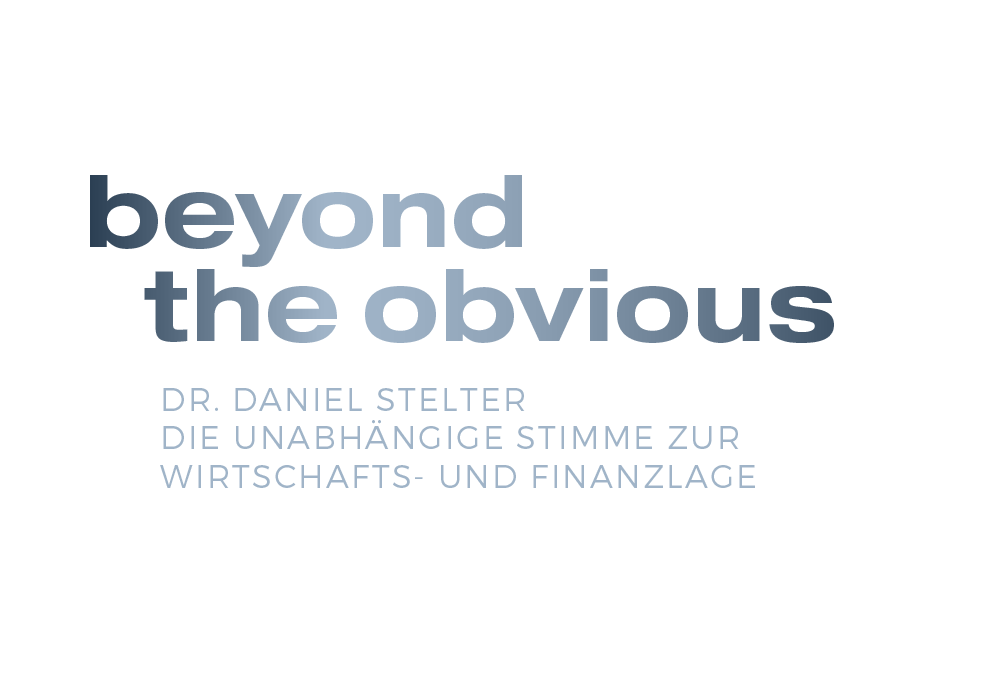Finanzkrisen und Kondratieff-Wellen
Vorgestern (28. Mai 2023) ging es im Podcast um die Kondratieff-Wellen, am kommenden Sonntag geht es um Finanzkrisen. Hier eine (mögliche) Verbindung der beiden:
Sind Finanzkrisen nur der Preis, den wir für wirtschaftlichen Fortschritt bezahlen müssen? Das Buch „Money Mania“ (Link) analysiert die Geschichte der Finanzkrisen bis ins Altertum („Kaiser Augustus war der erste Keynesianer“). Schlussfolgerung:
- Finanzkrisen ähneln sich: Es gibt die gleichen Abläufe im Rom der Antike, im England des 18. Jahrhunderts und im Jahr 2008.
- Es genügt nicht, Herdenverhalten und Irrationalität als Ursachen zu sehen. Auch billige Kredite genügen nicht als Begründung (– bto: Wobei es ohne sicherlich keine Finanzkrisen gäbe!).
- Vielmehr liegt es an der Komplexität des Finanzsystems. Nicht erst seit „Collateralised Debt Obligations“ und „Structured Investment Vehicles“ gibt es komplexe Finanzinstrumente. Die Griechen und Römer waren durchaus fortschrittlich, was Finanzinstrumente betrifft. Und weil die Komplexität schneller wächst, kommt es auch häufiger zu Krisen.
- Deshalb sollte man auf die Krise auch nicht mit mehr Komplexität – zum Beispiel neue Bankenregulierung, die dann ohnehin nur wieder umgangen wird – antworten. Besser: das Kreditwachstum in der Volkswirtschaft beschränken. (– bto: Völlig richtig. Zwar gibt es Kritiker einer solchen „makroprudenziellen Steuerung“, aber eine Begrenzung durch Kapitalunterlegungsregeln nach Wirtschaftssektoren ist noch lange keine Verstaatlichung des Bankensystems.)
- Außerdem müssen die Banken verkleinert werden. Ein „Too-big-to-fail“ darf es nicht mehr geben (– bto: Auch richtig).
Darüber hinaus betont der Autor, dass es eine Parallele zwischen Finanz- und Wirtschaftskrisen und dem wirtschaftlichen Fortschritt gibt. Viele große Erfindungen fallen in die Zeit von Blasen und Finanzkrisen. Demzufolge wären die Krisen der Preis, den wir für den Fortschritt bezahlen müssen.
Das sehe ich anders. Zum einen haben wir aus der Krise von 2008 nicht wirklich etwas gelernt. Zumindest sehe ich keinen Fortschritt bei Regulierung und fundamentalen Reformen. Stichwort: ungebremstes Schuldenwachstum. Aber das kann auch daran liegen, dass die Krise noch lange nicht zu Ende ist, sondern im Unterschied zur Depression der 1930er-Jahre in Zeitlupe abläuft.
Der Zusammenhang von Krisen und Fortschritt ist zwar gegeben, doch ist die Wechselwirkung eine andere. Dabei halte ich es mit der Theorie der langen Wellen der Konjunktur von Kondratieff.
Die gegenwärtige Situation lässt sich als „Winterphase“ einer sogenannten Kondratieff-Welle beschreiben. Nikolai Kondratieff, Ökonom und politischer Berater im Ministerium für Landwirtschaft und Finanzen, war 1920 Gründungsdirektor des Konjunkturinstituts in Moskau. Es sollte die ökonomische Lage der Sowjetunion und der wichtigsten kapitalistischen Länder beobachten.
Mit einer Vielzahl an Indikatoren – darunter der langfristigen Bewegung von Großhandelspreisen, Löhnen und Zinsen – ermittelte Kondratieff drei große Wellen der wirtschaftlichen Entwicklung von 1790 bis 1920 und prophezeite in der Verlängerung völlig korrekt die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre. Seine Theorie wurde später von dem österreichischen Wirtschaftswissenschaftler und Harvard-Professor Joseph Schumpeter aufgegriffen, der – zu Ehren des russischen Kollegen – von Kondratieff-Zyklen sprach. Kondratieff erlebte es nicht mehr, dass seine Theorie allgemeine Anerkennung fand: Er wurde 1938 hingerichtet, weil er Stalins Landwirtschaftsreform kritisiert hatte. Wahrscheinlich hat es ihm auch nicht gerade geholfen, dass er dem Kapitalismus zutraute, die Weltwirtschaftskrise zu überstehen.
Der klassische Kondratieff-Zyklus ist eine lange Welle der ökonomischen Entwicklung, die in der Regel 50 bis 60 Jahre anhält und in vier Phasen zerfällt:
Phase 1: Der „Frühling“ basiert auf Innovationen und der Umsetzung neuer Technologien und ist eine Expansionsphase, die den allgemeinen Wohlstand steigert und schließlich eine Inflation produziert. Diese Phase dauert rund 25 Jahre.
Phase 2: Der „Sommer“ hält nur flüchtige fünf Jahre lang an. Die Expansion erreicht ihren Höhepunkt, dann entstehen Probleme. Überproduktion führt zu Engpässen bei den Ressourcen, was die Kosten treibt und die Gewinne sinken lässt. Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich.
Phase 3: Der „Herbst“ währt rund zehn Jahre. In dieser Phase kommt es zur ersten Rezession des Kondratieff-Zyklus, danach tritt die Wirtschaft in eine Zeit mit stabilem, aber niedrigem Wachstum ein. In dieser Hochphase steigt dank niedriger Inflation und guter Wirtschaftsaussichten die Kreditaufnahme.
Phase 4: Der „Winter“ zieht sich im Schnitt über 18 Jahre hin. Er beginnt mit einem durch die hohe Verschuldung der Herbstphase ausgelösten langwierigen, rezessionsähnlichen Abschwung, der bis zu drei Jahren anhalten kann. Darauf folgt eine Periode von bis zu 15 Jahren mit niedrigen Wachstumsraten, bis der nächste Frühling kommt.
Welche treibenden Kräfte stehen hinter diesen Wellen der wirtschaftlichen Entwicklung? Die Wissenschaftler streiten über die Antwort. Für manche spiegeln die Wellen die sich verändernden Muster der Kapitalakkumulation oder der Verfügbarkeit von Rohstoffen und Nahrung, andere erklären die Wellen mit Kriegen oder sozialen Umstürzen. Doch nach der vorherrschenden Theorie – wie sie Schumpeter formuliert hat – ist technische Innovation die eigentliche Triebfeder der wirtschaftlichen Entwicklung.
Wissenschaftler haben insgesamt vier oder fünf Kondratieff-Wellen seit Ende des 18. Jahrhunderts identifiziert und ihnen die technischen Errungenschaften, die sie ausgelöst haben, zugeordnet. Die erste Welle, das Zeitalter der industriellen Revolution (1780 bis 1840), wurde von der Erfindung der Dampfmaschine und dem Wachstum der Textilindustrie beherrscht. Der Bau von Eisenbahnen und das Wachstum der Stahlindustrie standen hinter der zweiten Welle (1840 bis 1890). Initialzündung für die dritte Welle war die kommerzielle Nutzung der Elektrizität in großem Umfang (1890 bis 1940). Die vierte Welle ist mit der Entwicklung der Petrochemie und dem Aufkommen der Autoindustrie verbunden, durch die das 50 Jahre früher erfundene Auto zum Massengut wurde.
Manche sagen, die vierte Welle sei noch nicht vorbei, die Welt befinde sich in deren Winterphase, also in einer Periode verlangsamten Wachstums. Andere identifizieren eine kurze fünfte Welle seit 1980/1985, angetrieben von den neuen Informations- und Telekommunikationstechnologien. Aber auch nach dieser Sicht befinden wir uns aktuell in der Herbst- bzw. Winterphase. Allerdings sprechen viele Argumente dafür, dass die Zyklen technischer Innovation kürzer werden.
Ob nun vierte oder fünfte Welle – sollte die Theorie der Kondratieff-Wellen zutreffend sein, durchleben wir derzeit eine Abschwungphase, die einige Jahre anhalten kann. Die Grundlage für den nächsten Aufschwung wäre in der Expansion neuer Industrien zu sehen. Ansatzpunkte für solche Industrien erblickt man in der Biotechnologie, der Materialtechnik und der Umwelttechnologie. Auch die heute Morgen diskutierte Revolution im Automobilbau passt dazu.
Der Zusammenhang zwischen Finanzkrisen und technischem und wirtschaftlichen Fortschritt scheint damit zu bestehen. Aber er ist nicht zwangsläufig, denn Fortschritt könnten wir auch ohne Krisen haben.
Der Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Herbstphase, in der die alten Industrien weniger wachsen und eher über Konsolidierung und Kostensenkung versucht wird, die Margen zu halten und die neuen Industrien noch zu klein sind, um die Wirtschaft zu ziehen, müsste akzeptiert werden. Stattdessen versuchen Politik und alte Industrien über Schulden die Wachstumsraten hochzuhalten. Dann ist die Krise, ausgelöst durch die Schuldenlast, nicht mehr zu vermeiden. Doch ich bin nicht so optimistisch. In 60 Jahren, wenn es wieder so weit sein sollte, wird man die gleichen Fehler wieder machen.