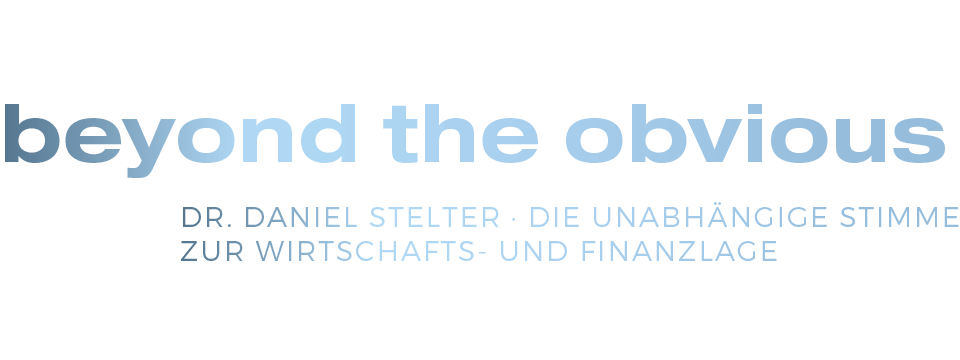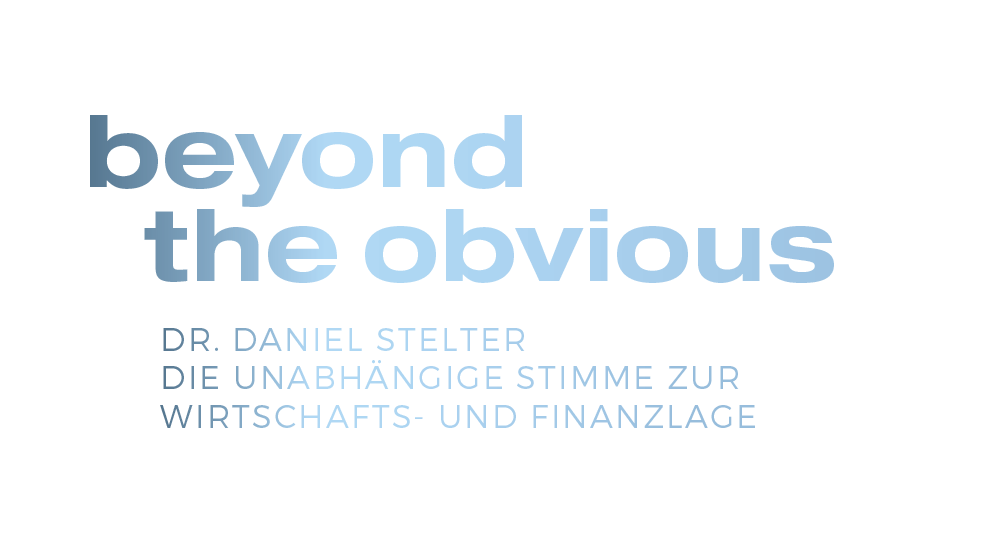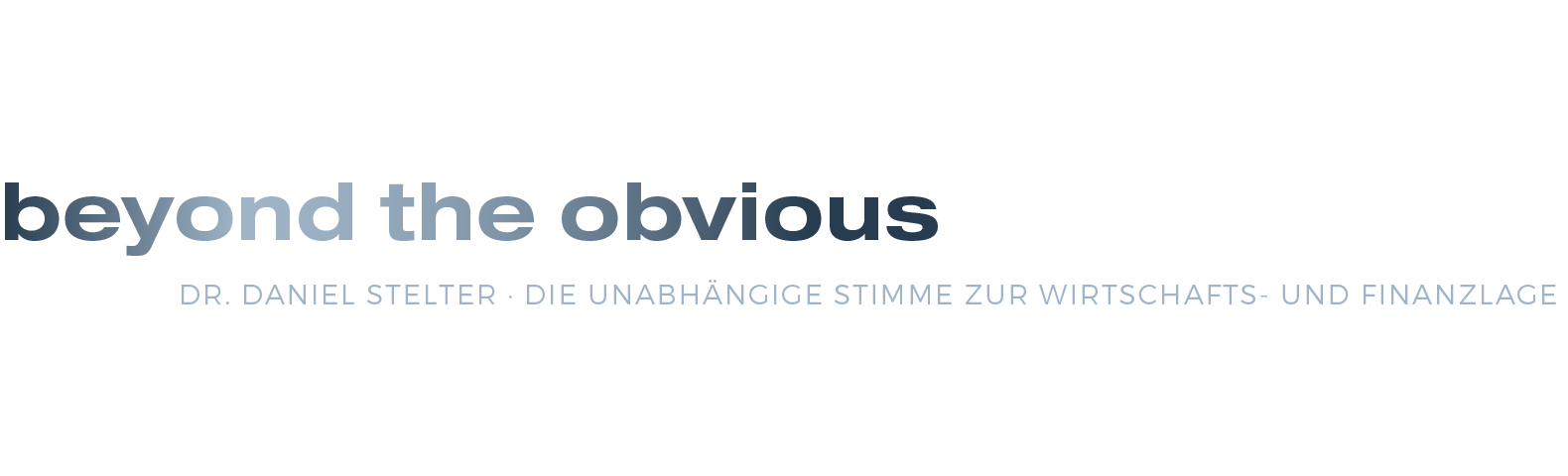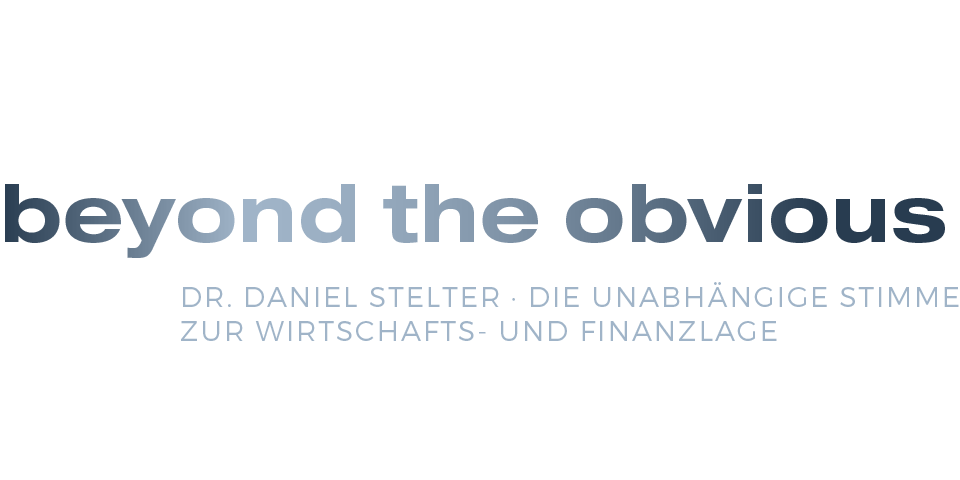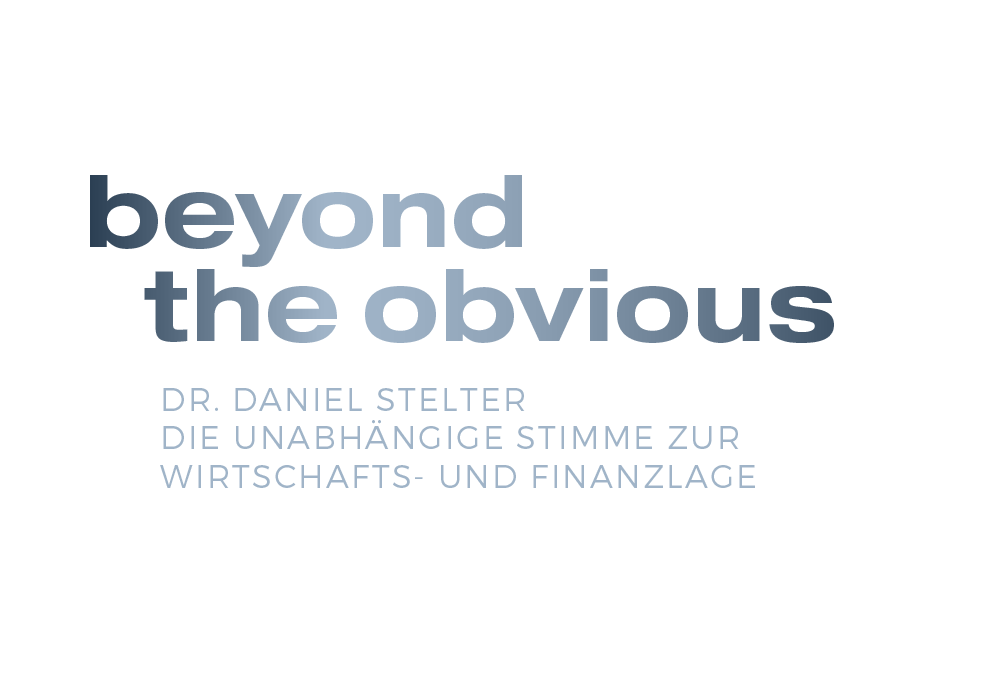Was Adam Smith der Bundesregierung raten würde
Am 16. Juni jährt sich der Geburtstag von Adam Smith zum dreihundertsten Mal. Seine Thesen sind heute noch hochaktuell. Im Gegensatz zum gerne verbreiteten Klischee war der Begründer der modernen Ökonomie keineswegs der erste „Marktradikale“, der einen „Laissez-faire-Kapitalismus“ und das Zurückdrängen des Staates propagierte.
Dieser Eindruck entstand, weil viele die Gedanken des Philosophen auf die Aussagen zur „unsichtbaren Hand“ des Marktes und die Bedeutung der Interessen des Einzelnen reduzierten.
Würde man Smith zur aktuellen Lage der Wirtschaft interviewen, würde er, auf Basis seiner schon damals entwickelten Einsichten, einiges kritisieren.
Zweifellos würde er anmerken, dass das Finanzsystem weit über die eigentliche Aufgabe der effizienten Zuteilung von Ressourcen hinausgewachsen ist. Smith erkannte die Bedeutung des Bankwesens für die Entwicklung der Wirtschaft an. Gleichzeitig warnte er vor Spekulation und davor, übermäßige Mengen an Papiergeld auszugeben, die nicht durch reale Vermögenswerte gedeckt sind.
Smith glaubte, dass dies zu wirtschaftlicher Instabilität führen und die Ressourcennutzung verzerren würde. Das sind Gefahren, denen wir uns auch heute gegenübersehen, verwenden wir doch seit Jahrzehnten Kredite vorwiegend zum Kauf von vorhandenen Vermögenswerten statt für Investitionen. Smith wäre sicherlich dafür eingetreten, das Bankwesen strenger zu regulieren.
Smith wäre Gegner des Heizungsgesetzes
Auch mit Blick auf die aktuelle Diskussion zur Deglobalisierung wäre die Position von Smith klar. Zwar zeigte er Verständnis für Bemühungen, die eigene Industrie zu schützen, fürchtete aber als Folge Wohlstandsverluste für die Verbraucher und geringeres Wirtschaftswachstum.
Das ist genau das, was angesichts der zunehmend protektionistischen Politik der EU, vorgetragen unter dem Deckmantel des Klimaschutzes und der strategischen Autonomie, nun droht.
Zur Klimapolitik hat sich Smith nicht geäußert, man kann aber angesichts seiner sonstigen Überlegungen davon ausgehen, dass ihm das Thema wichtig gewesen wäre. Seiner Meinung nach sollten sich alle Menschen und Unternehmen nachhaltig verhalten.
Als Instrumentarium wäre er wohl für eine Internalisierung der Kosten des Klimaschutzes in Form von CO2-Steuern oder Emissionszertifikaten eingetreten. Von staatlichen Vorgaben in Form von Heizungsgesetzen und Ähnlichem hätte er herzlich wenig gehalten.
Obwohl Smith mit James Watt, dem Erfinder der Dampfmaschine befreundet war, erkannte er deren Potenzial nicht. Dennoch war er sich der grundsätzlichen Bedeutung des technischen Fortschritts sehr bewusst.
Smith würde Chancengleichheit fördern
Er würde auf Bildung setzen, um Unternehmertum und Anpassungsfähigkeit zu fördern und sah darin eine Rolle für den Staat. So wäre es leichter, sich auf technologischen Wandel einzustellen und Zukunftsmärkte zu erschließen.
Auch die soziale Gerechtigkeit wäre Smith nicht egal gewesen. Er, der zeitlebens großzügig für die Armen gespendet hat, würde wahrscheinlich eine zu große Einkommensungleichheit kritisieren. Neben Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit, wie Investitionen in Bildung und Qualifizierung, würde er eine Rolle des Staates bei der Milderung extremer Ungleichheit sehen, wenngleich wohl nicht auf dem heute in Deutschland gegebenen Niveau.
Kurz gesagt: Smith wäre für einen starken Staat eingetreten, der Rahmenbedingungen setzt, die Voraussetzungen für den Wohlstand der Nation schaffen und diesen auch als Ziel verfolgt. In seinen Schriften betonte er, wie wichtig es sei, sachkundige Politiker zu haben, die die Komplexität der von ihnen behandelten Probleme verstehen. Smith argumentierte, dass nur eine auf großem Fachwissen basierende Entscheidungsfindung zu einer effektiven Regierungsführung geleite.
Ebenso wichtig waren Smith die Transparenz und Rechenschaftspflicht der Regierung. Kurz gesagt: ein kompetenter Staat, mit dem Ziel der Wohlfahrtsmehrung und dem Fokus auf günstige Rahmenbedingungen, statt kleinteiliger Detaileingriffe.
Als Berater der heutigen Bundesregierung hätte er da viel zu tun.
→ handelsblatt.com: “Was Adam Smith der Bundesregierung raten würde”, 11. Juni 2023