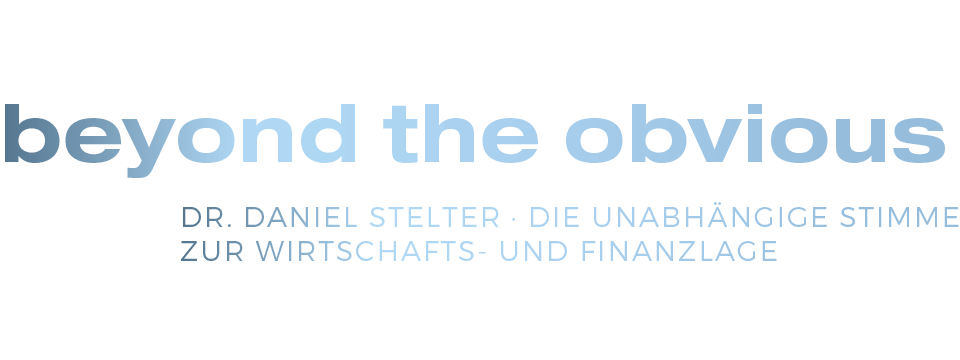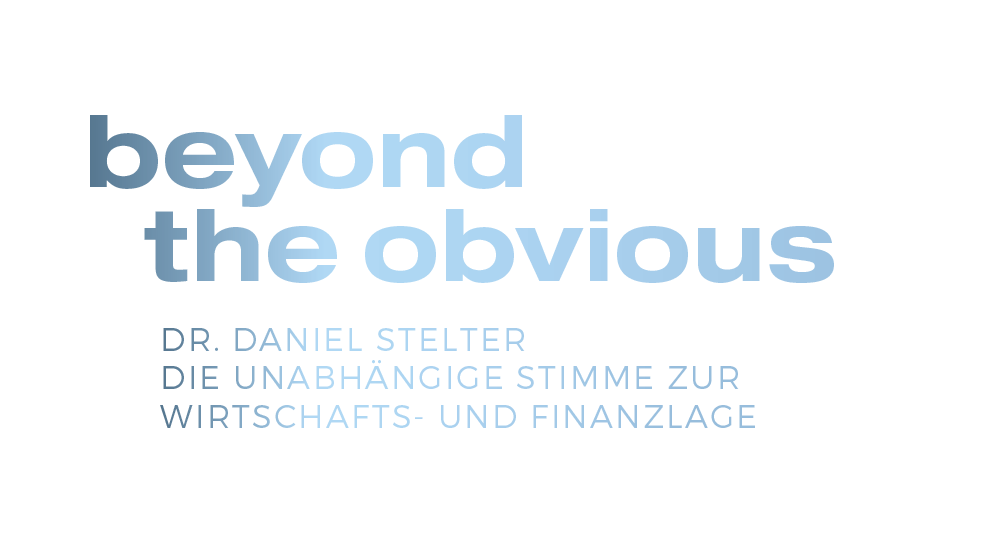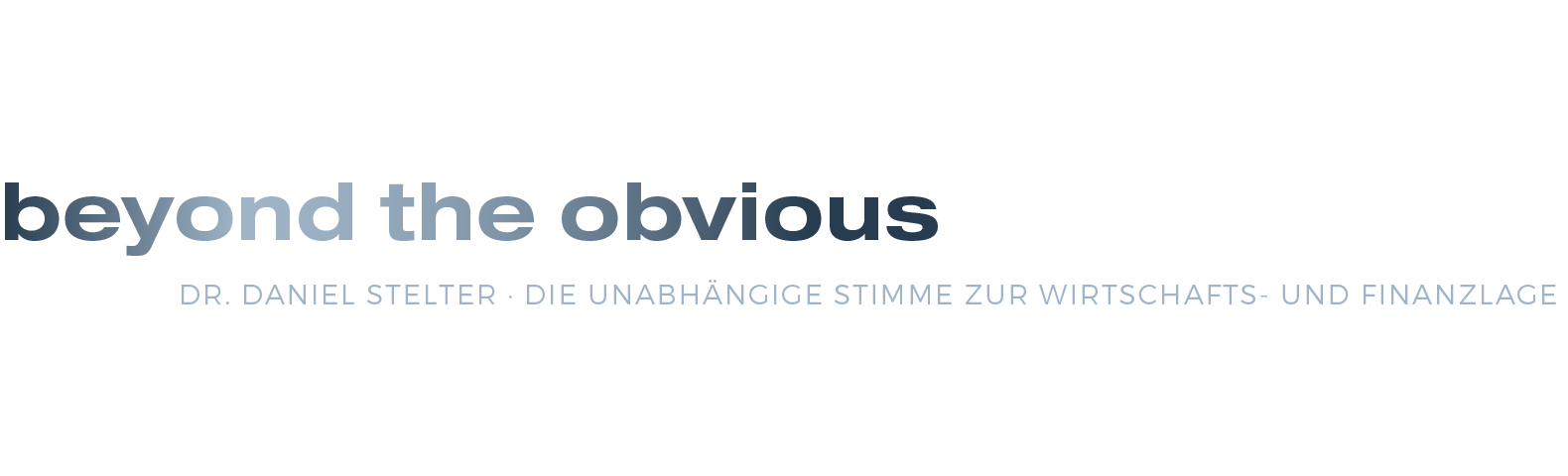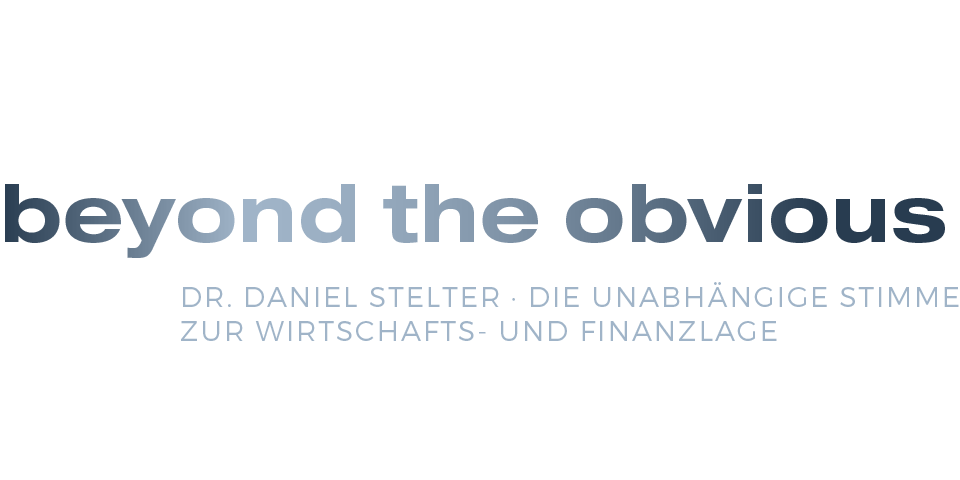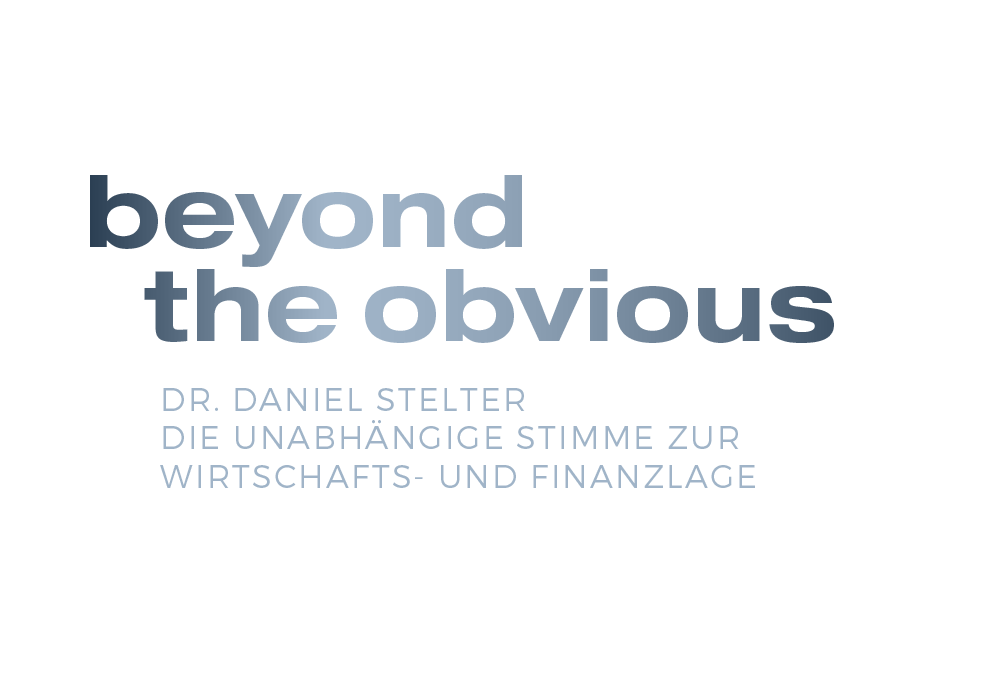Globale Mindeststeuer – zu früh gefreut
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zur globalen Mindeststeuer und die sich daraus ergebenden Gefahren – gerade auch für Deutschland – habe ich bereits diskutiert:
→ Die globale Mindeststeuer bringt wenig und birgt Gefahren
Jetzt, wo sich (fast) alle einig sind, dürfen wir uns darauf freuen. Denn auch ich finde, dass Unternehmen einen fairen Beitrag zur Finanzierung des Staates leisten sollten. Doch so einfach wird es nicht, lauern doch noch einige Fallstricke, wie die FINANCIAL TIMES (FT) bemerkte:
- “(…) the agreement by 130 countries to reform international corporate taxation is a big moment. (but) the outcome is mixed at best. Here is the good, the bad and the ugly of the reform.” – bto: Aus deutscher Sicht bringt es vor allem wenig und es dürfte sogar dazu führen, dass deutsche Unternehmen künftig mehr Steuern im Ausland und nicht bei uns bezahlen.
- “First, the good. The deal addresses the worst problems of international profit taxation. (…) When value instead resides in intangible services and intellectual property, it is a recipe for abuse. It is estimated, for example, that 40 per cent of global foreign direct ‘investment’ is structured to lower taxes rather than for actual business investment reasons.” – bto: Als normaler Steuerzahler freue ich mich natürlich, ist es doch recht ungerecht, derart hart angegangen zu werden von den hiesigen Steuerbehörden.
- “The deal attacks this by introducing a minimum global profit tax rate of 15 per cent and shifting the right to tax a slice of that profit from the place of residence to the place of sale. Economists who have crunched the numbers find this makes a significant, if not earth-shattering, difference. A forthcoming report by EconPol researchers Michael Devereux and Martin Simmler estimates that taxing rights to $87bn of profit will be redirected to countries of sale. France’s official Council of Economic Analysis (CAE) puts the number at $130bn. At typical rates, that amounts to $20-30bn worth of annual tax revenue.” – bto: Ja, der Hauptnutznießer sind die USA.
- “The minimum tax, the CAE finds, could raise corporate tax revenues by €6bn-€15bn for each of France, Germany and the US.” – bto: für Deutschland eher in der Größenordnung von fünf bis sechs Milliarden, wie gezeigt.
- “Now for the bad. The agreement only very partially solves the problem. Too few multinational corporations are included. Even with a minimum rate, most corporate profit will still be taxed according to the residence principle. The anomalies it spawns will therefore remain, too. The modest minimum rate leaves in place incentives to shift profits to low-tax jurisdictions (which therefore have little reason to complain).” – bto: Das ist zunächst für exportstarke Länder wie Deutschland eine gute Nachricht. Denn eine andere Verteilung ginge zu unseren Lasten.
- “Finally, the ugly. Governments have missed an opportunity to simplify the rules, leaving fertile ground for new and clever techniques to circumvent their intention. Rather than haggling about carve-outs and thresholds, leaders could have bargained over the relative weighting of investment, employment and sales in a fully formula-based allocation of multinational corporations’ entire global profits.” – bto: Na ja, ich finde es eher problematisch, dass Abschreibungsregeln etc. anders sind. Noch einmal: Nur nach einer Umverteilung zwischen den Ländern zu rufen, ist gerade aus unserer Sicht nicht vorteilhaft, aber auch nicht begründet.
- “This was a giant leap for politicians to make. Yet it remains a mere first step for the global economy.” – bto: Und wie mit der Schulden- und Transferunion wäre es gut, wenn Deutschland besser aufpasst.