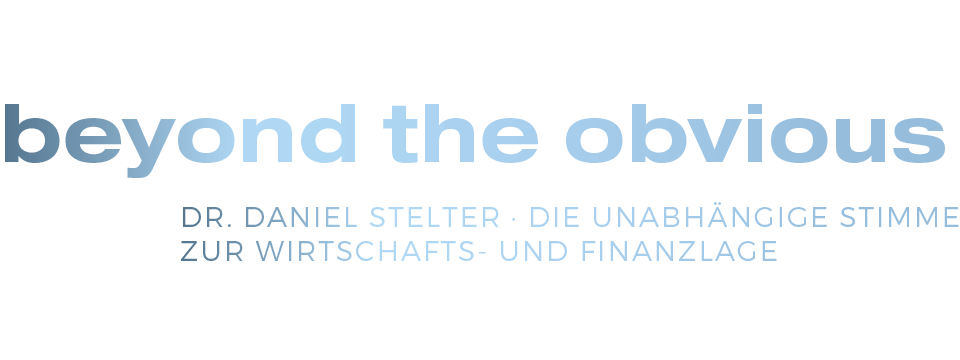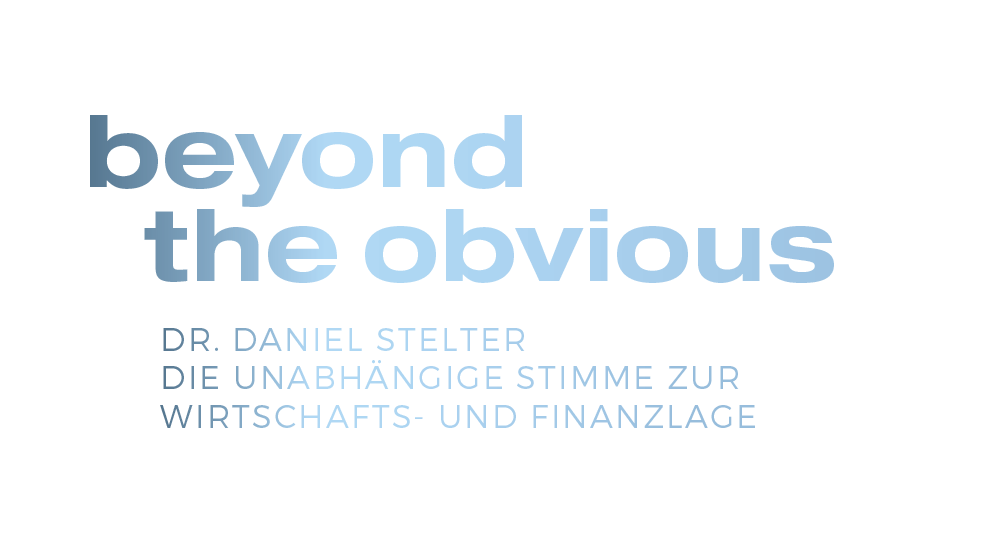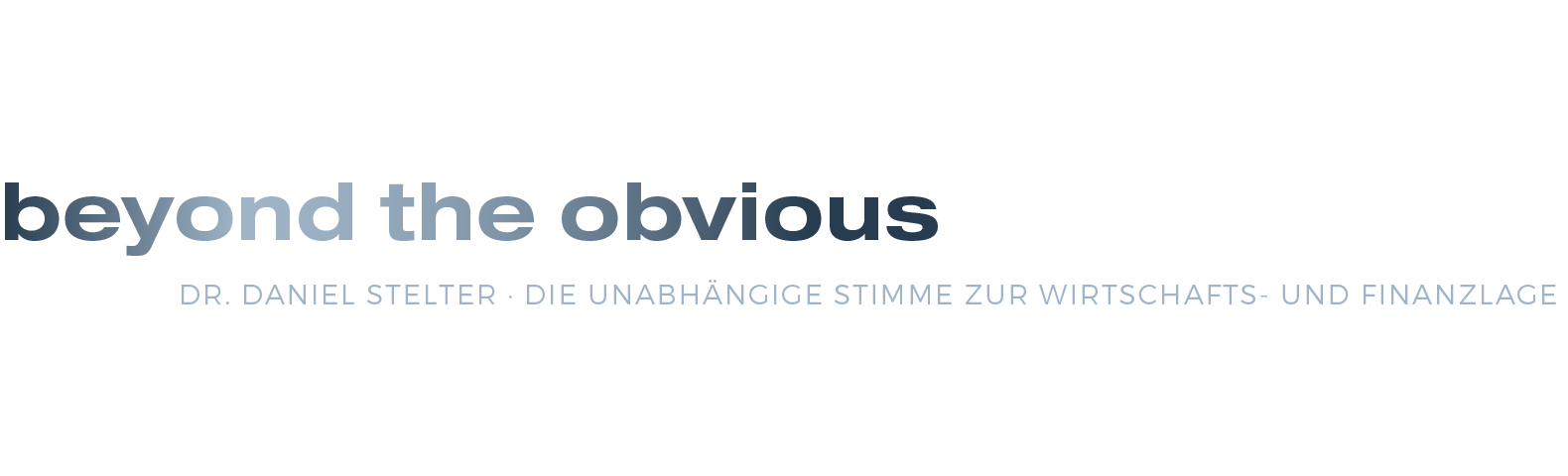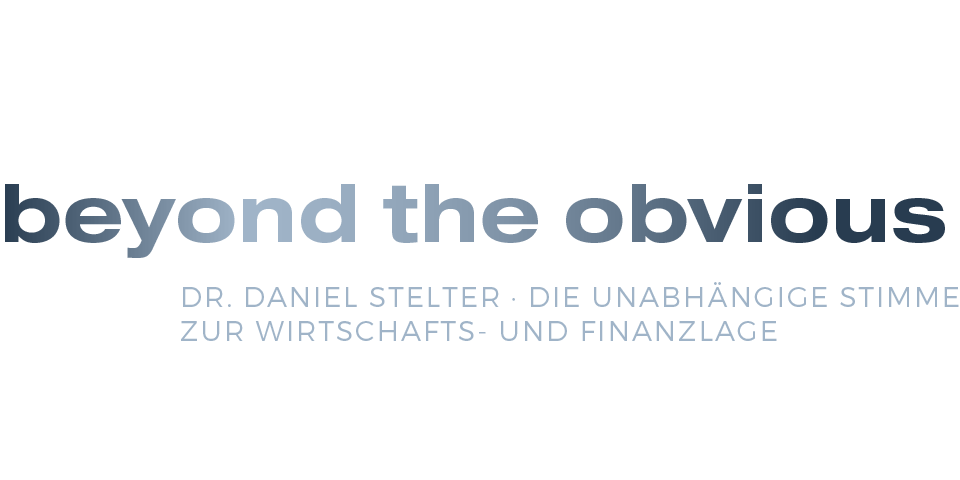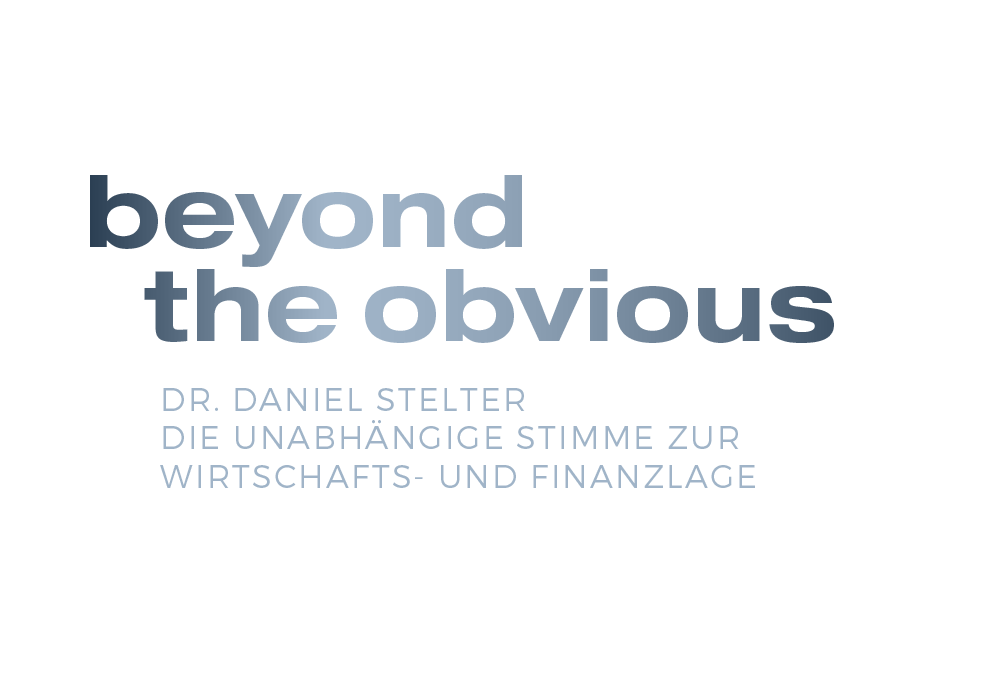Deutschlands Reiche und ihre Verantwortung
Mehr Reichtum für alle muss das strategische Ziel sein.
In der 87. Folge von „bto 2.0 – der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter“ geht es um Reichtum in Deutschland. Wer sind die Reichen? Ist ihr Reichtum unverdient und was sollten wir tun, um die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen? Dazu gibt es ein Gespräch mit Christian von Bechtolsheim und Dr. Nicolai Hammersen, die das Buch „Vermögen bedeutet Verantwortung“ veröffentlicht und dafür intensiv mit wohlhabenden Menschen gesprochen haben.
Täglich neue Analysen, Kommentare und Einschätzungen zur Wirtschafts- und Finanzlage finden Sie unter www.think-bto.com.
Sie erreichen die Redaktion unter podcast@think-bto.com. Wir freuen uns über Ihre Meinungen, Anregungen und Kritik.